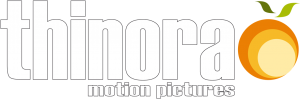Elmar Krekeler von WELT Kultur über „RÄUBERHÄNDE“: „Ein Film, der flirrt!“

Wo, bitte, geht’s hier zur Identität?
von Elmar Krekeler
Zwei Freunde reisen nach Istanbul und zu sich selbst. Der eine ist ein deutsches Lehrerkind, das sich nie fragen musste, wer es ist. Der andere sucht seine deutsch-türkischen Wurzeln. Jetzt gibt es das Schulbuch „Räuberhände“ auch als Film über das Fremdsein.
Früher, das ist schon ein bisschen her, wurden junge Männer, die schon damals vermutlich ihrer selbst viel unsicherer waren als junge Frauen, zur Festigung ihrer selbst und ihrer kulturellen Identität in den Süden geschickt. Von England, von Frankreich, Deutschland aus, gen Italien vor allem. Grand Tour nannte man das.
Wenn sich heutzutage – wenigstens suggerieren das Erwachsenwerdenromanbestseller wie „Tschick“ – junge Männer zum Zwecke der Selbstfindung, die für junge Männer nach dem Abitur immer noch sehr viel wichtiger zu sein scheint als für junge Frauen, auf den Weg machen, fahren sie nach Osten. In „Tschick“ war das der Fall. In „Räuberhände“ ist es eigentlich auch so.
„Räuberhände“, der 2007 (also drei Jahre vor Wolfgang Herrndorfs Ende-der-Pubertät-Klassiker) erschienene und längst zur Schulpflichtlektüre aufgestiegene Debütroman von Finn-Ole Heinrich, schickt – wie Herrndorfs „Tschick“ – zwei Jungs auf die Reise an die Ränder Europas. In die Türkei und ins Zentrum ihrer Identität.
Janik und Samu heißen sie. Dass sie uns irgendwann im Kino begegnen würden (Bestseller, Schullektüre, Bühnenhit), war bloß eine Frage der Zeit.
Dass sich der Studenten-Oscar-Preisträger Ilker Catak – geboren in Berlin, aufgewachsen in Istanbul, zum Filmemacher geworden in Deutschland, bekannt geworden mit der interkulturellen Liebesgeschichte „Es gilt das gesprochene Wort“ – des im Kern natürlich (Finn-Ole Heinrich hat sich nicht verstellt, erzählt „Räuberhände“ aus Janiks Perspektive) eurozentrischen Buches angenommen hat, ist ein Glücksfall.
Samu und Janik können nicht ohneeinander, sind Brüder im Geiste. Kind prekärer Verhältnisse – Mutter Deutsche und Alkoholikerin, Vater Türke und verschollen – der eine, Kind eines allesverstehendenallesverzeihenden linksliberalen Lehrerpaares der andere. In einer Gartenlaube, die sie gemeinsam in ein Paradies und ein Gewächshaus ihrer Träume verwandelt haben, geht alles los.
Der das Chaos gewohnte Samu, der die Ordnung sucht, und Janik, der aus der unendlichen Freiheit daheim endlich die Reibung der Fremde will. Sie träumen von Istanbul. Weil da die Wurzeln sind, weil da das Wilde ist.
Es gibt fast zu viele Brennpunkte in Heinrichs Buch. Es geht um Freundschaft, um Identität, sexuelles Erwachen, um die unmögliche Reibung an einem Elternhaus, das alle Reibung schon ausgelebt hat, alles richtig macht, um Heimat, Erwachsenwerden, um Familie, um Istanbul, die Stadt im Umbruch, im Aufbruch, die fremde Stadt, um all das, was einen – gerade, wenn einen die Hormone und das Umschalten im Kopf nicht zur Ruhe kommen lassen – irre werden lässt.
Ilker Catak macht einen Film daraus, der ist, wie das Leben ist, wenn man 19 ist und frei und auf dem Weg. Einen Film, der flirrt. Man könnte glatt ein bisschen neidisch werden. Aber das hält sich nicht lang.
Das interkulturelle Hin-und-her-Irren
Es ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Nicht das Zuschauen. Das Sein. Gerade das von Samu. Dessen prinzipielle Fremdheit, dessen interkulturelles Hin-und-her-Irren in der deutschen Datsche, wo sie ihr Abitur feiern, kein Thema ist. Kein Thema zu sein scheint. Das aber eines wird. Als Janik und er dann endlich, nachdem es zu einer entscheidenden Störung ihrer Freundschaft kam, die entscheidend mit Samus Mutter zu tun hat, ankommen in Istanbul.
Wo sie durch die Straßen ziehen. Wo sie Großstadtabenteuer erleben. Wo Samu ein Fremdling bleibt. Wo Samu seiner Fremdheit erst richtig bewusst wird. Und Janik seiner – was seine Identitätsprägung angeht – privilegierten Stellung.
Catak lässt nichts aus, beschönigt, romantisiert nichts, Istanbul – wo er groß wurde und wo sich mehr als die Hälfte von „Räuberhände“ ereignet – wird kein romantischer Sehnsuchtsort, kein Touristenkitsch, es ist eine gefährliche, brüchige, geheimnisvolle Stadt. Nicht ein touristischer Hotspot ist zu sehen. Die Bilder sind überstrahlt, die Szenen tanzen auf dünnem Seil. Samu kommt dem, was er sucht, nicht näher.
Ohne Emil von Schönfels, der sich anschickt, der nächste Jannis Niewöhner zu werden, ohne Mekyas Mulugeta als Samu, diese schillernde, selbstbewusste, selbst suchende Transit-Existenz, wäre das alles trotzdem nichts. So war das damals mit den Jungs. So wird es immer sein. Wo auch immer wir unsere Kinder auf ihre Grand Tour hinschicken. Auf welche Grand Tour auch immer sie gehen. Und welche Identitätsdebatten auch immer wir führen.
Kritik von Elmar Krekeler, 01.09.2021, WELT Kultur